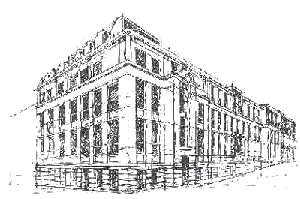AUF EIN WORT ...
Autopsie einer Sammlung: Die Anatomie des Dr. Tulp nach Rembrandt
 |
1632 gelang Rembrandt mit
seinem ersten Gruppenbildnis ein fulminanter Auftritt, mit dem er sich
durch die geschickte Verknüpfung von Erzählung und
Bildnis beim Amsterdamer Bürgertum empfahl. So zeigt denn das
Gemälde den berühmten Doktor Nicolaes Tulp, der im
Kreise seiner gelehrten Freunde eine Obduktion am Leichnam des zum Tode
durch den Strick verurteilten Verbrechers Namens Adriaen Adriaensz.
vornimmt. Dass er sich dabei nicht wie üblich erst der
Öffnung der Bauchhöhle, sondern der komplizierten
Sektion der Arm- und Handmuskulatur widmet, verweist auf den
berühmten niederländischen Anatom Andreas Vesalius,
der die Trennung zwischen 'praelector‘ und
ausführendem Anatom zu überwinden verstand, also
gleichzeitig obduzierte sowie dozierte, und der zudem die besondere
Bedeutung der Hand betonte, die er als 'primarium medicinae
instrumentum‘ bezeichnete.
Rembrandt gelingt es durch ein dichtes Bezugssystem aus Blick- und
Bewegungsrichtungen sowie durch Licht- und Schattenmodulationen,
gleichermaßen den Mediziner, die von ihm vertretende Methode
und vor allem seine Handfertigkeiten anschaulich in Szene zu setzten.
Während die rechte Hand die Ausführende ist, ist die
Linke nicht nur im Redegestus gehalten, sondern führt, analog
zur Demonstration am Sehnen- und Bandapparat der freigelegten Hand, den
Beugungsmechanismus der Finger vor. Damit haben Rembrandt und Dr. Tulp
ein bildliches Lehrstück geschaffen, in dem sich Vesalius
Ideal, nämlich den menschlichen Körper von innen und
außen, in Ruhe und Bewegung zu betrachten sowie darzustellen,
auf das eindrücklichste vereint.
Warum nun aber lässt ein Künstler und Sammler,
nämlich Franz Reiff, der zudem als Professor für
Figuren- und Landschaftszeichnen an der TH Aachen tätig war,
Ende des 19. Jahrhunderts eine Kopie von eben diesem Bild anfertigen?
Dass sich die Beantwortung der Frage dabei nicht auf Rembrandt als
Künstler fokussieren kann, lässt sich daran
festmachen, dass speziell für Aachen weitere Kopien seiner
Gemälde angefertigt wurden. Diese entstammen ausnahmslos den
Gemäldesammlungen Alter Meister in Kassel, Dresden und
München – den drei von Reiff aufgrund ihrer
Sammlungsschwerpunkte bevorzugten Galerien. Für die Kopie der
'Anatomiestunde des Dr. Tulp‘ wurde jedoch eigens ein
Berufskopist beauftragte, der in Den Haag um Erlaubnis anfragen und
vorstellig werden musste, womit ein erheblicher zeitlicher und
finanzieller Aufwand verbunden war.
Die sich hierin offenbarende Begehrlichkeit zirkuliert indes nicht um
die übergeordneten medizingeschichtlichen Aspekte, sondern
manifestiert sich vornehmlich an der besonderen Darstellung und
Prominenz der Hand. Seit dem 15., verstärkt dann im 16.
Jahrhundert hatten die Künstler eine Nobilitierung der Hand
sowie die Vergeistigung des 'Hand‘-werks gefordert, um die
Hand als Werkzeug des Geistes respektive als Instrument, welches den
geistigen Entwurf des Künstlers sichtbar macht, in den Fokus
zu rücken. So beanspruchte zum Beispiel Albrecht
Dürer nicht nur den schöpferischen Geist für
sich, sondern auch die Handfertigkeit, diesen sichtbar werden zu
lassen. Selbstredend unterstützten die neu gewonnenen
naturwissenschaftlichen Gesichtspunkte, welche die hochkomplexe
Mechanik der Hand offen legten, diesen Prozess.
Weitere Beispiele ließen sich mühelos
anführen. Wichtiger erscheint jedoch, dass Reiff sich dieser
Tradition verpflichtet sah, verstärkt sehen musste, da er es
als oberste Prämisse verstand, sich als Künstler in
der Phase der technischen Reproduzierbarkeit von Kunst zu behaupten. So
spielte das Anfertigen von Originalkopien, die von
Künstlerhand hergestellt wurden und neben Komposition, Licht
und Farbe auch den Duktus bzw. die Manier erkennbar werden
ließen, für Reiff als Maler und für die
Ausrichtung seiner Sammlung eine zentrale Rolle.
Zudem sah Franz Reiff in dem Rembrandt-Gemälde vermutlich
seine eigenen Ideale versinnbildlicht, nämlich die von ihm
proklamierte Einheit von Theorie und Praxis in der Lehre. Als
Besonderheit darf gelten, das Reiff, der mit seinen Werken das Entree
der Sammlung bespielte, seine Fertigkeiten in die vermeintliche
Opposition von zeitgenössischer Kunst und Alten Meistern
einzuflechten verstand – sozusagen als raumbezogenes
Gruppenbild mit einer Persönlichkeit im Mittelpunkt, die
Künstler, Sammler und Lehrer zugleich verkörperte.
Dr. Martina Dlugaiczyk
|
|