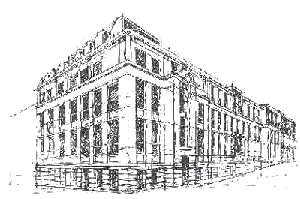HISTORISCHER EINBLICK IN DIE SAMMLUNG
|
Dieses
historische Foto mit
der
Bildunterschrift |
1) Frans Snyders 'Eine Löwin schlägt ein Wildschwein' 2) Anton van Dyck 'Sebastian Leerse mit Frau und Sohn' 3) Anton van Dyck 'Kardinal Guido Bentivoglio' 4-6) ? 7) Frans Snyders 'Wildschweine im Kampf mit Hunden' 8) Peter Paul Rubens 'Landschaft mit Kühen' 9) Peter Paul Rubens 'Rubens Söhne (Albert und Nikolaus)' 10) Peter Paul Rubens 'Susanna im Bade' 11) Jacob Jordaens 'Faun bei einer Bauernfamilie auf Besuch' 12) Peter Paul Rubens 'Putten, Detail zum Blumenkranz' 13) Albrecht Dürer 'Johannes und Petrus (Die hl. Johannes Evangelist und Petrus)' |
Die Quellenlage
Über die museale Raumdisposition und -präsentation
der Reiffschen Sammlung geben vornehmlich schriftliche Zeugnisse
Auskunft. Wichtigste Quelle dabei ist die Aachener Zeitung
‚Echo der Gegenwart'1
, in der in aller Regelmäßigkeit - positiv wie
negativ - über das Reiff-Museum berichtet wurde. Leider
jeweils ohne beigestelltes Fotomaterial.
Einzig dem ‚Zentralblatt der Bauverwaltung' lässt
sich der Ausgabe vom 30. April 1910 ein Foto mit der Bildunterschrift
‚Großer Museumssaal'2
entnehmen. Ein Glücksfall. Zwar geben die schriftlichen
Quellen reichlich Auskunft über Wandverkleidung,
Fußbodenbelag, Lichtregie, also der Ausgestaltung der
Räume, die für die Zeit eine sehr moderne war3,
und vermitteln dem Leser die Abfolge der Säle und ihre
Bestimmung, aber anhand des Fotos lassen sich augenscheinlich weitere
konzeptionelle, schriftlich aber nicht fixierte Angaben entnehmen.
Das
historische Foto
Vorab einige Daten: Die Museumseröffnung fand am 5. November
1908 statt; die erste öffentliche Ausstellung erfolgte vom
9.11 - 5.12.19094
und das historische Foto wurde in der Ausgabe vom 30. April 1910
publiziert. Diese zeitliche Abfolge gilt es im Auge zu behalten, da die
Sammlung unter Max Schmid-Burgk ständigen Wandlungen
unterworfen war.
Das Foto gewährt Einblick in den großen Museumssaal,
der mittels Ober- und sparsam eingesetztem künstlichem Licht
beleuchtet und durch zwei Scherenwände in drei Kabinette
strukturiert wurde. Vom Objektiv erfasst ist die Längsseite
des Saales, die zugleich die Schmalseite des zum Templergraben
abschließenden Gebäudes darstellt.
Nach eingehender Sichtung des Fotos sowie parallel dazu des Inventars
konnte ein Großteil der im mittleren Kabinett - welches den
Flamen vorbehalten war - vorhandenen Bilder zugeordnet werden. Von
links nach rechts ergibt sich folgende Benennung:
1) Frans Snyders 'Eine Löwin schlägt ein
Wildschwein',
2) Anton van Dyck 'Sebastian Leerse mit Frau und Sohn',
3) Anton van Dyck ‚Kardinal Guido Bentivoglio',
4-6) ?,
7) Frans Snyders ‚'Wildschweine im Kampf mit Hunden',
8) Peter Paul Rubens 'Landschaft mit Kühen',
9) Peter Paul Rubens 'Rubens Söhne (Albert und Nikolaus)',
10) Peter Paul Rubens 'Susanna im Bade',
11) Jacob Jordaens 'Faun bei einer Bauernfamilie auf Besuch',
12) Peter Paul Rubens 'Putten, Detail zum Blumenkranz'.
Folgt man dem Inventar von 1901, dürfte es sich bei den
kleinformatigen Werken 4-6 um Bilder nach Teniers oder Breughel
handeln. Die Maße sprächen dafür.
Allerdings, und das gestaltet die Forschungslage nicht einfacher, das
großformatige Gemälde ‚Kardinal Guido
Bentivoglio' nach van Dyck wurde, da es im Inventar unerwähnt
ist, erst nach 1901 in die Sammlung aufgenommen.
Ganz rechts erkennt man unschwer eine der Tafeln mit den Aposteln nach
Albrecht Dürer (Nr. 13) wodurch die Abteilung Deutscher
Künstler markiert ist. Dazu gehörten Werke nach
Holbein, Schongauer und Cranach. Spekuliert werden darf, dass sich
linker Hand, also nach den Flamen, die Niederländer zur
Anschauung darboten.
Ferner offenbart das Foto, wie modern und konservativ zugleich die
Sammlung präsentiert wurde. So stand der den neuesten
Ansprüchen gerecht werdenden Raumgestaltung die barocke
Hängung entgegen. In drei horizontalen Reihen, dicht an dicht
platziert, entsprach die Anordnung, die letztlich dem Platzmangel
geschuldet ist, nicht der von Schmid-Burgk favorisierten, die den Fokus
auf ein Bild gerichtet hätte. Durch die Form der
‚integrierten Ausstellung' versuchte er dieses Manko (will
man es denn so benennen) wieder wettzumachen. So wurden Möbel,
Skulpturen, Vitrinen mit Kleinkunst usw. den Gemälden zur
Seite gestellt und kleinere Abteilungen nach
wahrnehmungsästhetischen Gesichtspunkten gestaltet.
Sammlungsschwerpunkt
Ob der Fotograf Anweisungen erhalten hat, gerade dieses Kabinett
abzulichten, ist nicht überliefert, aber zu vermuten. Nach
Auswertung des Inventars von 1901 ergibt sich nämlich, dass
der Sammlungsschwerpunkt eindeutig im Bereich der
niederländisch-flämischen Kunst des 16. und 17.
Jahrhunderts zu verzeichnen ist; darunter 12 Kopien nach Rembrandt, 6
nach Rubens, 6 nach van Dyck, 5 nach Hals usw. Hinzu kommen Werke, die
1901 noch italienischen, heute jedoch niederländischen bzw.
flämischen Künstlern zugeschrieben sind. So z.B. im
Fall des Studienkopfes von Ludovico Carracci (Inv. Nr. 28), der seit
1985 gesichert als eine Arbeit aus dem Umfeld von van Dyck gilt5.
Dieser Schwerpunkt entsprach dem Geschmack der Zeit des auslaufenden
19. Jahrhunderts, der durch den Unterricht an die Studierenden sowie
durch die Zugänglichkeit des Museums und Berichterstattung dem
(Fach-)Publikum weiter vermittelt wurde. Mit Akzeptanz durfte gerechnet
werden. Das sollte sich jedoch bald ändern, weil neben
Reproduktionen und Diapositiven vor allem die Moderne Einzug hielt.
Größenverhältnisse
Das Reiffsche Inventar von 1901 verzeichnet neben
Künstlernamen, Titel des Werkes, Ort, gelegentlich die
Inventarnummern6
und die Maße. All diese Angaben sind dem jeweiligen Original
zuzuordnen, bis auf die Maßangaben. Diese sind den Kopien
entnommen. Dabei ist auffällig, dass die heutige Praxis,
Höhe vor Breite vor Tiefe zu notieren, nicht eingehalten
wurde. Vielmehr wurde die Reihenfolge willkürlich vorgenommen.
Das lässt sich augenscheinlich dem historischen Foto
entnehmen. Während das Werk nach Jordaens (Nr. 11) den
Maßen 126 x 110 cm entspricht, müssen die Angaben
(85 x 50 cm) zu dem darunter hängenden Rubensbild (Nr. 12),
welches eindeutig ein Querformat darstellt, genau anders herum gelesen
werden.
Versuche, ein einheitliches Verhältnis zwischen den
Maßen der Originale und der Kopien herzustellen, gestalten
sich schwierig. So wurden z.B. die beiden als Pendants gemalten Werke
von Frans Snyders in den Kopien (Nr. 1 und 7) auf die Hälfte
minimiert, aus Rubens ‚Madonna im Blumenkranz'
‚nur' die beiden rechts oben befindlichen Putten in
vergrößerter Form kopiert (übrigens ein bis
heute gern gewählter Ausschnitt), während das Werk
nach Jordaens (Nr. 11) um knapp ein Drittel verkleinert und die
Maße von van Dycks Familienbildnis (Nr. 2) fast 1:1
übernommen wurden.
Ob Franz Reiff, der die Werke in seiner Privatwohnung sowie im
Gartenpavillon an der Ludwigsallee 39 und im universitären
Atelier (Hauptgebäude der RWTH Aachen, 2. Stock) beherbergte,
nach einem vorgegeben Größenplan bestellte, ist
wahrscheinlich, aber nicht belegbar. Die Pläne für
den Museumsneubau hatten auf jeden Fall noch nicht einmal das
Reißbrett erreicht. So erklärt es sich, warum ein
Hauptwerk, das in keiner Kopiensammlung fehlen durfte7,
nämlich ‚Die Sixtinische Madonna' nach Raffael,
nicht in den eigentlichen Museumsräumen, sondern in einem sich
auf gleicher Etage befindlichen Maleratelier von Professor Frenz8
präsentiert wurde. Die Ausmaße des Bildes sowie der
aufwändig geschmückte Zierrahmen hätten die
Möglichkeiten der Museumswände gesprengt.
Dr. Martina Dlugaiczyk
1
siehe Dokumente:
Quellen
2
Zentralblatt der Bauverwaltung, hrsg. im Ministerium der
öffentlichen Arbeiten, XXX. Jahrgang, Nr. 35, Berlin, 30.
April 1910, S. 239. Hier findet sich auch ein detaillierter
Grundriß aller Stockwerke mit Nutzungszuweisung der einzelnen
Räume, ebda.
3
Schmid-Burgk besuchte z.B. "in Hagen die Sammlung des 1900 bis 1902
gegründeten Museums Folkwang von Karl Ernst Osthaus, in
Darmstadt das 1897-1902 von Alfred Messel (…) erbaute
großherzogliche Museum und Hannover das Provinzialmuseum",
Turck, 1992, S. 53.
4
Katalog der Drucksachen Ausstellung
5
Schnackenburg, Mainz 1996, S. 112. Erste Zuschreibung an van Dyck
Umkreis nahm vor: Schleier, E.: Besprechung Lehman, Kat. 1980, in:
Burlington Magazine CXXXVII, Sept. 1985, S. 626-28
6
Inventarnummern finden sich im Reiffschen Inventar von 1901
durchgängig nur bei den Vorlagen aus der Münchner
Alten und Neuen Pinakothek.
7
Pophanken, Andrea: Graf Schack als Kunstsammler. Private
Kunstförderung in München (1857-1874),
München 1995.
8 "Mit
Beginn des Wintersemesters ist der am Templergraben gelegene Neubau der
Hochschule, der das Reiffmuseum birgt, offiziell der "Neubau der
Abteilung 1 und des Reiffmuseums", in Benutzung genommen worden. Im
allgemeinen ist über den Bau zu sagen, daß er im
Kellergeschoß Magazin-, Dienst- und Bureauräume
enthält, im Erdgeschoß das Kunstgeschichtliche
Institut (Prof. Schmid), die Baukunst der Renaissance und die
Räume des Prof. Frenzen, im
ersten Stockwerk die
Architektursammlungen (Geheimräte Henrici und
Schupmann), im
zweiten Stock das Reiffmuseum und die Unterrichtsräume des
Professors für Malerei (Prof. Frenz)"; Echo der Gegenwart, 05. November 1908: Bericht
von
der Eröffnung des
Reiffmuseums
|
|